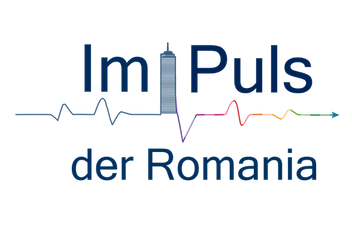Speaker
Description
Aimé Césaire begründet den Einsatz von Flora und Fauna in La Poésie wie folgt: „En les nommant, flore, faune, dans leur étrangeté, je participe à leur force; je participe de leur force.“ Im Cahier d’un retour au pays natal gibt es mehrere Stellen, in welchen ‚enfer‘ explizit genannt wird: „Les chants ne s’arrêtent pas, mais ils roulent maintenant inquiets et lourds par les vallées de la peur, les tunnels de l’angoisse et les feux de l’enfer.“ / „Donc notre enfer vous prendra au collet. Notre enfer fera ployer vos maigres ossatures. Vos grâces de tétras lyrure n’exorciseront rien.“ Auch in Les armes miraculeuses gibt es konkrete Relationen zwischen Flora und Hölle: „à boulets rouges d’enfer et de fleurs pour la première fois“ (Avis de tire) / „Ah ! je sens l’enfer des délices“ (Les pur-sang) / „M’avancerais-je caressé déjà de soleil pâle vers le ciels / où mes crimes et le long effilochement d’herbes de mes enfers colonisés“ (Le grand midi). Aimé Césaire verwendet in vielen seiner Gedichte eine Bildlichkeit ‚infernaler Flammen‘, die zerstörerischer Natur sind. Es ergibt sich damit ein triadisches Geflecht von plantes – enfer – flammes, das sich wechselwirksam konfiguriert und in diesem Vortrag im Kontext des Postkolonialismus vorgestellt werden soll. Kurzum: Aimé Césaire verbindet mit der Platzierung seiner Pflanzen ganz bewusst ‚Vegetation‘ mit ‚Hölle’ und etabliert ein vegetatives Höllen-Netzwerk. Im entfernten Sinne könnte so eine ‚pflanzliche‘ Art der Geschichtsschreibung aussehen. Mit ‚pflanzlicher Geschichtsschreibung’ ist gemeint, dass die Pflanzen in den kolonialisierten Gebieten eine deutlich höhere Lebenszeit als Menschen besitzen und so die gesamte Zeitspanne der Kolonialgeschichte ‚miterlebt‘ haben. So sind Pflanzen bei Aimé Césaire stets emotionsvermittelnde Fixpunkte in der konstruierten Räumlichkeit des Gedichts und besonders deswegen von außergewöhnlicher Bedeutung.