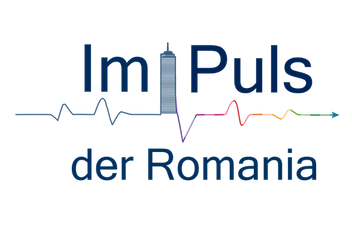Speaker
Description
Die im Pariser Klimaabkommen 2015 beschlossene Grenze eines weltweiten Temperaturanstiegs von 1,5 Grad Celsius kann zukünftig nur noch durch eine enorme Reduktion von Treibhausgasemissionen eingehalten werden (WWF, 2024).
Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler:innen vor den globalen Auswirkungen durch technologische und industrielle Fortschritte bei der Ausbeutung und Zerstörung der Umwelt und die damit zusammenhängende Klimakrise. Seit den 70er Jahren wurde daher ein Umdenken weg von einer anthropozentrischen Perspektive des Rechts hin zu einer ökozentrischen gefordert (Bosselmann, 1992). Die Diskussion der Etablierung von subjektiven Rechten für die Natur ist heute aktueller denn je.
Während in Lateinamerika bereits in Ecuador und Bolivien die Natur als Rechtssubjekt in der Verfassung integriert ist, sowie in Kolumbien die Rechte des Río Atrato anerkannt wurden, sind die gerichtlichen Urteile hierzu in Europa noch zurückhaltend. Bisher nimmt Spanien als erstes europäisches Land mit der Zusprechung von Rechten für die Salzwasserlagune Mar Menor eine Vorreiterrolle ein.
Um den Diskurs um die Anerkennung des Ökosystems aus einer diskurs- und textlinguistischen Perspektive zu erforschen, wurde ein ausgewähltes spanischsprachiges Korpus aus bisher 120 Zeitungsartikeln der renommierten Zeitungen El País und El Mundo sowohl quantitativ als auch qualitativ untersucht, wobei insbesondere auf die sprachliche Konstruktion der Zuschreibung von Handlungsmächtigkeit lebender und nicht-lebender Entitäten wie Ökosysteme, Tiere und Pflanzen geachtet wird. Dabei sollen zudem sowohl sprachliche Muster der Akteur:innen bezüglich Strategien, Argumentationen und Narrativen als auch implizite Wissensschemata im Sinne eines „Common Ground“ der Sprachteilnehmer:innen aufgedeckt werden. Dies wird durch die Herausarbeitung von Metaphern und Schlagworten sowie Argumentationstopoi möglich. Auch die Rolle der Natur als Opfer und semantischer Experiencer wird hier sichtbar und soll mit Kontexten von Gewalterzählungen und darin beschriebenen Täter-Opfer-Darstellungen in Beziehung gesetzt werden.