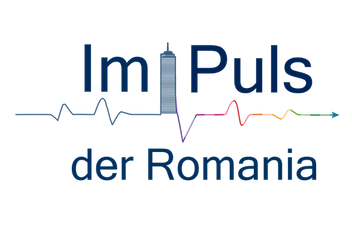Speaker
Description
Chile ist ein politisch, ökonomisch, sprachlich und kulturell zentralisierter Staat, dessen Zentrum die Hauptstadt Santiago bildet, während der „Rest“ des Landes de facto als Hinterland angesehen wird. Der letzte Versuch, diese Ordnung grundlegend zu verändern, war die sogenannte Revolution von 1851. Alle späteren Reformanstrengungen haben den Zentralismus bestenfalls abgeschwächt, wie etwa die Verlegung des chilenischen Kongresses nach Valparaíso (bereits 1987), oder wurden vom Staatsvolk abgelehnt, wie 2022 und 2023 im Kontext der Referenden über eine neue chilenische Verfassung.
Gleichwohl hat die Kritik an diesen zentralistischen Strukturen eine lange Tradition. Bereits Daniel Barros Grez tadelte ironisch in seinem Theaterstück Como en Santiago (1881), dass die regionalen Eliten den gesellschaftlichen Lebensstil der Hauptstadt, welche ihrerseits die europäische Belle Époque imitierte, schlicht nachahmten (Imitatio). Der „Vater“ des chilenischen Criollismo, Mariano Latorre, schreibt seinerseits, zum Beispiel, in Cuentos del Maule (1912) und Chile, País de Rincones (1947) gegen die mangelnde (literarische) Repräsentation der regionalen chilenischen Identitäten, v.a. seiner Heimatregion (Maule), an.
An diese Überlegungen, speziell an das Konzept der Escritura de la tierra, knüpft der Dichter, Essayist und Universitätsprofessor Fidel Sepúlveda Llanos (1936-2006) bewusst an. Seinem Heimatort Cobquecura stets verbunden, widmet er sich dem Studium des immateriellen Kulturerbes der heutigen Ñuble Region, welches durch populäre, rurale und indigene Einflüsse geprägt ist, sowie durch eine besondere Naturverbundenheit. In diesem Sinne entwickelt Sepúlveda in seinen Werken, wie Patrimonio, identidad, tradición y creatividad (2010), einen Gegendiskurs zu zentralistischen Perspektiven, die die regionalen Identitäten Chiles marginalisieren bzw. subalternisieren und ihre Natur als auszubeutende Rohstoffe ansehen (Extractivismo).
Ziel des Vortrags ist es, die Kontinuitäten im zentralistisch kritischen Diskurs in Chile nachzuzeichnen und aufzuzeigen, warum (legale) Reformvorhaben, wie die notwendige Dezentralisierung in all ihren Dimensionen, nur bedingt Erfolg haben können, insofern sie nicht von einem mentalen und kulturellen Wandel, einer „Bewusstwerdung“ der eigenen Identität bzw. Identitäten im Sinne Hegels, begleitet werden.